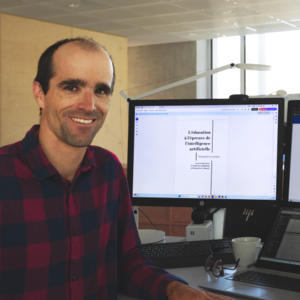Das Bildungswesen war schon immer technikbegeistert. Denken Sie an Overheadprojektoren, das Internet oder Videokonferenzen. Ausserdem gibt es Forschung zur KI in der Bildung (AIED – Artificial Intelligence in Education) bereits seit über 50 Jahren. Doch erst in den 2010er-Jahren nahm die personalisierte Lernunter-stützung durch KI richtig Fahrt auf. Khan Academy beispielsweise nutzte grosse Mengen an Lerndaten, um Inhalte individuell anzupassen.
Neu ist, dass die heute am häufigsten genutzten Werkzeuge – ChatGPT, Copilot, Gemini und andere – nicht speziell für den Bildungsbereich entwickelt wurden. Dennoch halten sie im grossen Stil Einzug in die Klassen-zimmer – oft ohne klare Richtlinien oder Aufsicht.